Autor

"Wäre das Schreiben nicht, würde ich implodieren." sagt M.Kruppe, dessen Texte meist aus einem inneren (An-)Trieb entstehen, ohne von vorn herein als Veröffentlichungen geplant zu sein. "Zwei Drittel dessen, was ich schreibe, wird nie veröffentlicht werden, weil das Schreiben für mich in erster Linie ein Erleichtern ist. Man könnte auch sagen: einen therapeutischen Zweck erfüllt."
M.Kruppe's Prosa entsteht vorwiegend in Form von Tagebucheinträgen, die sich manchmal zusammenführen lassen. Dabei achtet er nicht auf gängige Formen und Maßgaben des literarischen Schreibens. Vielmehr könnte man das, was er verfasst und veröffentlicht, "intuitives Schreiben" nennen. Auch deshalb sieht er sich eher im Underground, als in der Welt der etablierten Literatur, auf die er, wie er sagt, keine Lust hat.
Was in den Neunzigern mit naiven Versuchen, Gedichte zu schreiben begann, wurde in den letzten Jahren unkonventionelle Prosa. Die erste Veröffentlichung fand noch unter dem "Druck" von Freunden statt, die es gut meinten. So erschien "Krieg im Nimmerland" beim legendären und leider nicht mehr existenten Leipziger Verlag Edition PaperOne.
Heute ist Kruppe froh, dass dieses Buch nicht mehr im Handel zu haben ist. Dennoch wäre er nicht da, wo er heute ist, hätte es "Krieg im Nimmerland" nicht gegeben. Über den Verlag lernte er zunächst Volly Tanner (der das Vorwort zum Buch schrieb), später Hauke von Grimm, Dirk Rotzsch und Michael Schweßinger kennen, die "Revierköter", eine Gruppe von Underground-Literaten der Nuller Jahre in Leipzig. Mit Michael Schweßinger verbindet Kruppe heute noch eine gute Freundschaft.
Dieses Buch war der Schlüssel zu einer Szene, die dem in thüringischen Pößneck lebenden Möchtegern-Autor bis dahin verborgen blieb. Kruppe machte erste Erfahrungen mit Lesungen, lernte weitere für ihn wichtige Menschen, wie den Autor und damaligen Kneipier Markus Böhme kennen, der bis zur Zwangsschließung 2016 die Metal- und Kulturkneipe Helheim leitete.
Als Kruppe zwischen 2010 und 2012 erstmals in Leipzig lebte, war das Helheim sein zweites Wohnzimmer. Hier traf sich der Underground, hier las er, trank er, schrieb er und war regelmäßiger Gast der Lesebühne Tanners Terrasse. Nur so konnte er anknüpfen, sich austauschen, lernen, was Schreiben eigentlich ist.


Dennoch dauerte es acht Jahre bis zur Veröffentlichung des zweiten Buches "Lange Nächte in Tiflis".
Als Kruppe 2014 von einem langjährigen Freund und ehemaligen Mitbewohner Johannes Fötzsch gefragt wurde, ob er Lust auf ein Abenteuer hätte, wäre er geneigt gewesen, ja zu sagen, wenn es sich nicht um einen zweijährigen trip "auf dem Landweg nach New York" gehandelt hätte und die Voraussetzung gewesen wäre, einen Motorradführerschein zu machen. Denn dieser Trip sollte mit alten Ural-Motorrädern stattfinden. Zu ängstlich und vor allem: gerade frisch verliebt und in einer neuen Beziehung, lehnte Kruppe ab, bot aber an, über die Reise zu berichten. So entstand die Kooperation mit dem Projekt leavinghomefunktion, der Mitteldeutschen Zeitung und MDR Figaro.
Kruppe begleitete ein dreiviertel Jahr die Vorbereitungen in Halle/Saale und schrieb dann regelmäßige Berichte über das Vorankommen des Abenteurer-Quintetts, in der er regelmäßig mit den Beteiligten telefonierte, um sich auf den aktuellen Stand bringen zu lassen.
Im Dezember 2014 kamen die Fünf im geplanten Winterlager, einem dreistöckigen Häuschen in Tserowanie (nahe Tiflis) an und luden neben einigen anderen Freunden auch M.Kruppe ein, den Jahreswechsel gemeinsam in Georgien zu verbringen. Kruppe brachte seinen ersten Flug hinter sich, reiste überhaupt zum ersten Mal in seinem Leben allein und bekämpfte seine Angst und Aufregung mit schreiben. So entstand "Lange Nächte in Tiflis"
Von Sein und Zeit entstand eher zufällig. Kruppe schrieb viel, veröffentlichte wenig, bis sich im Frühjahr 2015 Tristan Rosenkranz bei ihm meldete. Die beiden kannten sich über den einst gemeinsamen Verlag Edition PaperOne, den es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gab. Er habe, so sagte Rosenkranz, die Idee, einen Verlag zu gründen, Kruppe, so führte er weiter aus, verfüge über ein Netzwerk und man können ja zusammenkommen. Die Edition Outbird entstand, an der sich Kruppe wirtschaftlich nicht beteiligte, jedoch bis heute "künstlerischer Mitarbeiter" ist. Kruppe stellte ein Konvolut aus Texten zusammen und war der erste Autor, der im neuen Verlag veröffentlichte. Der Saalfeder Künstler und Photografiker Stefan Jüttner steuerte hier einige seiner Arbeiten bei.
Dass der Titel des Buches dem eines bekannten Philosophen ähnelt, war Kruppe nicht bewusst. Es handelt sich hier vielmehr um Betrachtungen, Überlegungen, Beschreibungen eines Schreibenden in einer ostdeutschen Kleinstadt in Gedichtform und Kurzprosa.


Anders war es bei "Und in mir Weizenfelder". Die Idee einer Sammlung von zumeist prosaischen, aber auch surrealen Gedichten entstand bereits im Jahr 2009 . Seit dem arbeitete Kruppe an den Texten und finalisierte das Buch während eines Ostsee-Urlaubs 2016, weswegen auch einige Texte einen Bezug zur Ostsee haben.
Im selben Jahr interviewte M.Kruppe für das Kulturmagazin Outscapes dessen Herausgeber der Verleger Tristan Rosenkranz war, Dr. Mark Benecke. Aus einem geplant einstündigen Interview wurde in einem Café in Erfurt ein mehrstündiges Gespräch, über Beneckes Arbeit, dessen Interesse für Architektur und Brücken, aber auch für Literatur. Als Kruppe beiläufig erwähnte, dass sein viertes Buch kurz vor der Veröffentlichung steht, bot Benecke an, ein Vorwort zu schreiben. Im Zuge dessen entstand eine gemeinsame Arbeit an den Weizenfeldern, denn der Kriminalbiologe erwies sich als hervorragender Lektor, der das Buch erheblich zu verbessern wusste.
So erschien "Und in mir Weizenfelder" im November 2016 ebenfalls im Verlag Edition Outbird.
Das Titelgedicht ist von Henrik Ibsens "Peer Gynt" bzw. der Verfilmung des Stücks in der Version von Uwe Janson (2006) inspiriert, in dem Robert Stadlober die Hauptrolle spielt. Stadlober zeigte sich begeistert, als er von M.Kruppe während eines Treffens auf der Literatur- und Kunstburg Ranis 2024 erfuhr, dass die Rolle Peer Gynt, eine explizite Szene im Film, vor allem aber Stadlober selbst die Quelle der Inspiration zu einem Gedicht gewesen sind.
In den "Geschichten vom Kaff der guten Hoffnung" nimmt M.Kruppe weniger Abschied von der thüringischen Kleinstadt, in der er aufgewachsen ist, sondern vielmehr von den Menschen, die dort leben. Vor allem denjenigen Menschen, die am so genannten Rand der Gesellschaft auf den Pfaden des Rausches balancieren. Er nimmt Abschied von den Kleinstadt-Trinkern, vom Stehausschank, von Menschen, die "gehen mussten" , von Drogenkonsumenten und vom Anker Kind. Er nimmt Abschied, denn "diese Kleinstadt ist auserzählt", wie er 2021 in einem Interview in der Literatursendung Blaubart & Ginster sagte.
In diesem Buch zeigt sich erstmals, aber noch sehr undeutlich, Kruppes Entwicklung weg vom Gedicht, hin zu erzählender Prosa. Unter dem Lektorat seines "literarischen Vertrauten" und Freundes Ralf Schönfelder, entstand ein Werk, das den Künstler und Tausendsassa Holger Much noch vor Veröffentlichung begeisterte, so dass dieser Vorschlug, sowohl einige Illustrationen, als auch das Cover-Bild beizusteuern. Dies nahm Kruppe freilich gern an und sagte später in oben schon erwähntem Interview, dass er stolz darauf sein, mit dem großartigen Illustrator, Musiker, Autor Holger Much ein gemeinsames Werk geschaffen zu haben.
"Dieses Buch" sagte Kruppe in einem anderen Interview "war das Schließen der Tür zum Kapitel Pößneck. Hoffnung gab es lange in diesem Kaff, aber auch die Hoffnung stirbt irgendwann ... wenn auch zuletzt."
Noch im Erscheinungsjahr des Buches, 2020, zog Kruppe zurück nach Leipzig.

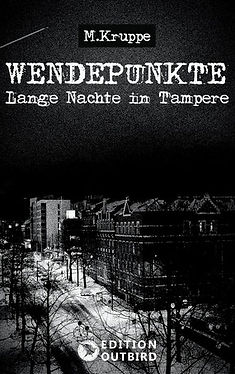
Als Kruppe im Januar 2022 gefragt wird, ob er Lust habe, ein Stipendium in Finnland anzunehmen, stand das Wort Nein ganz groß in seinem Kopf. Wenn es geheißen hätte Karibik oder Fuerteventura oder wenigstens Griechenland, hätte Kruppe nicht gezögert. Erst als er die Summe des Honorars hörte und wusste, dass er davon all seine Schulden bezahlen könne, willigte er ein und fand sich nur drei Wochen später im finnischen Tampere wieder. Vier Wochen lang bewohnte er ein kleines Haus im waldreichen Stadtteil Haihara, wo er schrieb, wenn er nicht in Schulen Vorträge, im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen des Deutschen Kulturzentrum Tampere und des Finnisch-Deutschen-Vereins Tampere Lesungen hielt oder mit Studierenden des Germanistik-Kurses an der Universität der Stadt Interview-Videos editierte.
"Als ich dieses doch recht dicke Buch dann im November des Jahres zum ersten mal in den Händen hielt, war mein erster Gedanke: Und das habe ich geschrieben? Dass das so viel ist, war mich gar nicht bewusst." sagt Kruppe.
In den Wendepunkten beschäftigt sich der Autor mit seiner Vergangenheit als Punk, mit der ersten infantilen Liebe, mit dem ersten Familien-Auto zu DDR Zeiten, mit der DDR an sich, aber freilich auch mit Finnland, mit der Sprache und den Menschen. Eine Busfahrt wird zu Abenteuer und erinnert an eine Zugfahrt in den 90ern und Kruppe erfährt während seines Aufenthalts in Tampere vom frühen Tod eines Freundes, was ebenfalls ins Buch einfließt.
Den Abschluss bildet das Langgedicht "Wendepunkte", in dem sich der Autor mit seiner Alkoholsucht außeinandersetzt.